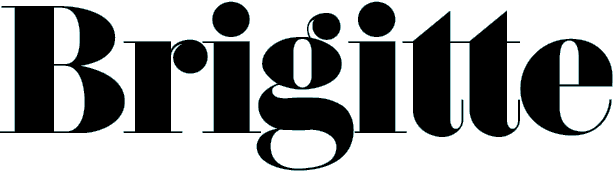
Es wird Zeit – die Kolumne
Über zehn Jahre lang erschien in der Zeitschrift BRIGITTE meine Kolumne. Ich habe sie geliebt! Ich fragte Menschen, die es besser wussten und sammelte wunderbare Ansichten und Einsichten! Über die Liebe, das Geld, die Sterne, über Erziehung, Vergänglichkeit und Haustiere. Ein Glück! In meinem Buch "Porblemzonen" sind viele dieser Kolumnen versammelt - und hier auch!

BRIGITTE 03/2022
Sinn gesucht!
Sinn ist in. Die Sinnsuche kommt einer Trendsportart gleich wie Geocaching, Mindful Running und Stand-Up-Paddling. Ein angesagtes Hobby für Menschen, die keine existenzielle Not leiden, die es sich leisten können, ihr Dasein zu hinterfragen und sich über ihre höhere Bestimmung Gedanken zu machen. Wem nichts fehlt, der sucht nach Sinn.
Ein Luxusgut für gelangweilte Besserverdienende?
Tatjana Schnell ist die einzige Sinn-Professorin im deutschsprachigen Raum und hat vor 20 Jahren mit ihrer Forschung begonnen. „Natürlich braucht man den Freiraum, um über Sinnfragen nachdenken zu können. Und obwohl es dabei immer um das ‚mehr‘ geht, ist Sinn kein Luxusgut für eine Wellness-Society,“ sagt sie. „Es geht dabei um Ehrlich-keit mit sich selbst, um die eigenen Werte, darum, was man wichtig und was man richtig findet und ob es gelingt, konsequent nach diesen Maßstäben zu leben. Das verlang Mut und Durchhaltevermögen.“
Ich stelle fest, dass ich mit zunehmendem Alter mehr Sinn in meinem Leben benötige. Ähnlich wie ich reichhaltigere Cremes, stärkere Brillengläser und blick-dichtere Strumpfhosen brauche. Meine Knochen verlangen nach einem Calcium-Supplement, meine Seele nach Sinn-Ergänzungsmitteln. Als ich meine beiden Söhne bekam, war ich sinnmäßig für einige Jahre ruhig gestellt und mehr als zufrieden. Mein Leben war erfüllt durch die Sorge um andere, der Sinn des Lebens war mir quasi bei der Geburt frei Haus mitgeliefert worden. Alles war in sich stimmig. Leider war auch das eine Phase, die vorbeiging, ebenso wie die Zeit, wo Kinder immer lecker riechen und Mama die Größte ist.
„Es gibt Sinnphasen im Leben. Relativ unwichtig ist er im mittleren Lebensabschnitt und seine Bedeutung steigt ab 60 deutlich an,“ sagt die Expertin. „Dabei ist beim Sinn nicht das Hauptkriterium, sich gut zu fühlen, denn das Richtige ist nicht immer das Angenehme.“ Auch das noch, denke ich. Nicht nur schwer zu finden, sondern auch noch anstrengend im Unterhalt.
Der Top Act unter den Sinnstiftern, das lerne ich von Tatjana Schnell, ist die Generativität, die Erik H. Erikson beschrieb mit den schönen Worten: „Die Liebe in die Zukunft tragen.“ Wer Kinder großzieht, wer Wissen und Werte weitergibt, wer das Gefühl hat durch seine Kunst, seine Arbeit, sein Schaffen die Zukunft über die eigene hinaus zu gestalten, empfindet das Leben als sinnvoll. Das Wort „Sinn“, erklärt mir die Expertin, leitet sich aus dem Indogermanischen her, dort bedeutet es: „Einer Fährte folgen, den eigenen Weg gehen“. Das Leben ergibt für uns Sinn, wenn wir so leben, wie wir es für richtig halten, kongruent mit unseren Überzeugungen, wenn wir dazugehören, wenn wir einen Platz haben und wenn es einen Unterschied macht, ob es uns gibt oder nicht.
Der schnellste Weg zum Sinn? Profesorin Tatjana Schnell kennt ihn: „Muten Sie sich Sinnsuche zu! Und finden Sie ihn im Naheliegenden.
Heben Sie den Müll von der Straße auf.
Schenken Sie jemandem ein Lächeln.“
Denn dann macht man einen Unterschied.

BRIGITTE 02/2022
Wie alt bin ich gerade?
Manchmal fühle ich mich jung. Zu jung.
Wie eine Fünfjährige, der so gut wie nichts schnell genug gehen kann, die ihr Weihnachtsgeschenk im Spätsommer haben will und gekränkt ist, wenn andere Menschen andere Meinungen haben. Mein inneres Kind ist ein radikales, verletzliches Geschöpf, das sich für den Nabel der Welt hält. Ein halbes Jahrhundert später habe ich als Erwachsene ein-sehen müssen, dass die Welt mich nicht für ihren Nabel hält, wobei der kindliche Anteil in mir immer noch findet, dass die Welt damit nicht unbedingt recht hat. Zu jedem Kind gehören Eltern, die es geprägt haben. Und da Eltern auch Menschen sind und es keine perfekten Menschen gibt, gibt es keine perfekten Kindheiten. Wir alle tragen ungesunde und höchst subjektive Überzeugungen in uns, die nichts mit der Realität zu tun haben, sondern mit unseren frühesten Prägungen.
Stefanie Stahl, Psychologin und Autorin des Bestsellers „Das Kind in dir muss Heimat finden“, erklärt mir und meinem inneren Kind, wie wichtig es ist, uralte Voreinstellungen zu erkennen und umzuprogrammieren. „Wir müssen den Zusammenhang zwischen unseren heuti-gen Reaktionen und unseren Kindheitsprägungen erkennen. Ohne das Wissen um die Grundmelodie unseres Lebens haben wir keine Entscheidungsfreiheit und bleiben ferngesteuert. Beim Umschalten auf unser erwachsenes Ich begeben wir uns von der Identifikation mit einem Gefühl in die Beobachterposition. Je öfter uns das gelingt, desto seltener geraten wir in die alten Zustände. Unser Gehirn lernt, anders zu fühlen.“
Erwachsen werden bedeutet wachsen. Und Wachstum bringt immer eine Veränderung der Größenverhältnisse mit sich. Eltern schrumpfen auf ein Normalmaß, was sich wie ein Verrat anfühlen kann, und Freunde, Partnerinnen, Männer, Chefinnen verlieren an Glanz oder an Macht, wenn man ihnen nicht mehr aus der Perspektive eines Schattenkindes gegenübertritt, das sich falsch einschätzt und oft das Gefühl verinnerlicht hat, schuld zu sein und nicht zu genügen. „Wenn man die Schuld immer bei sich lässt, behält man paradoxerweise die Kontrolle über das Geschehen“, sagt Stefanie Stahl. „Denn sobald man herausgefunden hat, wer man nicht ist, muss man sich fragen: Wer bin ich denn dann?“
Das ist ein holpriger Weg. Manchmal fühle ich mich, als sei ich noch mal Mutter geworden. Dann bin ich sowohl die Hand, die hält, als auch die Hand, die sich festhält. Trostsuchend und tröstend, verzweifelt und vernünftig, ängstlich und beruhigend, klein und groß, suchend und findend. „Die Welt braucht weise und reflektierte Menschen, und jede von uns braucht einen starken und Halt gebenden inneren Erwachsenen“, sagt Stefanie Stahl.
Ach ja, die Welt.
Sind wir nicht irgendwie alle der Nabel der Welt?
Ich denke, auf diesen Kompromissgedanken würde sich mein inneres Kind einlassen.

BRIGITTE 01/2022
Was ist aus mir geworden?
Sie schleicht sich an. Drängelt sich durch zwischen Geschenken und Gebäck, macht sich breit im Hirn und im Herzen, stellt sich, auch ungebeten, während sich das Jahr dem Ende zuneigt. Die Frage nach der Verwandlung. Was haben die vergangenen zwölf Monate aus mir gemacht? Habe ich mich lediglich verändert oder entwickelt? Wer war ich damals, wer bin ich heute? Wo und wann hat Verwandlung stattgefunden, und habe ich sie in meinem Sinne selbst gestaltet?
Mich hat ein Buch durch dieses Jahr begleitet, in dem ich immer wieder Halt, Inspiration und durchaus auch ein bisschen Glück gefunden habe. In „Der unendliche Augenblick“ reihen sich sanfte und kluge Sätze aneinander, die von dem Leben erzählen, das kein Erfolgsprojekt ist, von der Hoffnung als Botschaft des Frühlings, von der Schönheit einer renditefreien Gegenwart, der Trauer als dem Vertrauen ins Unsichtbare und den Übergängen als den poetischen Zonen im Leben, in denen Verwandlung stattfinden kann.
Aber ist Verwandlung nicht etwas, was automatisch mit uns passiert, so wie Faltenkriegen und Gelenkverschleiß, frage ich die Autorin des Buches, die Philosophin Dr. Natalie Knapp. „Wir denken von uns als Produkt, das irgendwann fertig ist. Das sind wir nicht. Wir sind ein Wandlungsraum. Die Einwilligung in diese Tatsache ist ein wichtiger Schritt. Ich bin zum Beispiel in den Wechseljahren. Eine Zeit im Leben einer Frau, über die man eigentlich nicht spricht. Ich kann nicht selbst bestimmen, welche Symptome auftreten, aber ich kann mich entscheiden, wie ich mich dazu verhalte. Ich mache Erfahrungen, die ich mir nicht ausgesucht habe, und ich weiß, dass ich
jetzt noch nicht wissen kann, wie die Zeit mich verwandeln wird, welche andere Art von Weisheit und Weiblichkeit ich später entwickelt haben werde. Ich befinde mich in einem wertvollen Erfahrungsraum. Das ist eine hilfreiche Art von Selbstdistanzierung, Akzeptanz und Milde.“
Ich mag diese Form der aktiven und entschiedenen Hingabe und würde sie gern besser beherrschen. Sich dem Lebensfluss nicht zu widersetzen und ihn gleichzeitig genau dadurch aktiv und positiv zu beeinflussen.
„Erst wenn wir loslassen und in unsere eigene Verwandlung einwilligen, werden wir innerlich weit und offen, sodass das Neue auf die Welt kommen kann“, sagt Dr. Knapp, die Wandlungsexpertin. „Hingabe bedeutet nicht aufgeben, sondern Ja sagen zu können zu dem, was ist, und dieses radikale Akzeptieren gleicht einem magischen Akt.“
Ja! Ja sagen zur Magie der Verwandlung. Ich finde, das ist ein guter Vorsatz für ein gutes, neues Jahr!

BRIGITTE 26/2021
Ich bin spät dran
Es ist schon fast Weihnachten, und Sie haben noch keinen Adventskalender. Sie erwägen eine schnelle Trennung, bloß um ihrem Partner nichts schenken zu müssen, und planen, sich gezielt mit einem moderaten, aber nachhaltigen Magen-Darm-Virus infizieren zu lassen, um die Zeit bis zum Jahreswechsel genau da zu verbringen, wo man die vermeintlich besinnlichsten Tage des Jahres verbringen sollte: zu Hause auf dem Sofa, mit der Fernbedienung im Arm und flankiert von einem dicken Roman und dünnen Tee.
Willkommen im „Verein zur Entschleunigung der Adventszeit“, zu deren Vorsitzender ich mich jedes Jahr wiederwähle. In diesem Jahr verschenke ich zur Drosselung des vorweihnachtlichen Tempos ein Besinnungs-Best-of: die Top-Ten- Gedanken nachdenklicher Frauen, die mich im Laufe des Jahres an dieser Stelle beeindruckt, bewegt und verändert haben. Wer sagt denn, dass die Tür zu unserem Adventskalender nicht die Tür ist, die wir hinter uns schließen, um endlich unsere Ruhe zu haben?
Denn: „Es liegt eine Magie darin, immer wieder alles infrage zu stellen“, sagt Stefanie Luxat, und ich bemühe mich, das ständig zu beherzigen, weil alles auch ganz anders sein kann. „Das Leben ist eine Ansammlung von Selbst-versuchen mit ungewissem Ausgang“, sagt Meike Winnemuth, und ich werde in Zukunft mehr solcher Versuche wagen. „Selbstzweifel, Teamgeist, Risikovermeidung, Empathie – das sind Führungsqualitäten! Und die alten Säcke haben keine einzige davon“, sagt Gerburg Jahnke, und ich empöre mich gern mit ihr darüber.
„Irgendwann werde ich bei ihm sein. Und bis dahin will ich leben“, sagt Dr. Iris Killinger, die ihr Kind verloren und mir durch ihre Haltung Kraft geschenkt hat. „Wir alle sind unter den wertenden Blicken von Männern aufgewachsen. Heute müssen und dürfen wir uns davon lösen, Männern gefallen zu wollen“, sagt Anne Amerie-Siemens und hilft mir, ungefällig und ich selbst zu werden.
„Unser Nein stärkt unser seelisches Immunsystem. Mit jedem Nein über-nehme ich Eigenverantwortung und verteidige meine Lebenszeit. Nein ist nicht nur ein Wort, es ist ein Weg“, sagt Annette Lies und macht aus mir eine stolze Neinsagerin. „Als erwachsene Tochter trägt man die Verantwortung für sein Glück allein. Man muss aushalten lernen, dass der Vater Schwächen hat“, sagt Susann Sitzler und unterstützt mich dabei, nicht länger Papas kleines Mädchen zu sein. „Veränderung braucht Mut. Es ist nie zu spät, den eingeschlagenen Weg zu verlassen. Das heißt nicht, dass er falsch war. Er ist nur zu Ende“, sagt Ragnhild Struss und ermutigt mich, neue Wege zu gehen.
„Ich habe mehr denn je das Gefühl, es fängt doch gerade erst so richtig an, Spaß zu machen! Natürlich ist das Leben der Fruchtbarkeit, das Leben als knackiges, scharfes Ding vorbei – aber die Energie, die jetzt frei wird, die Möglichkeiten gepaart mit der Erfahrung und den neuen Freiheiten, die wir haben, finde ich sensationell“, sagt Maria Furtwängler und hat damit einfach nur recht!
Ich wünsche eine besinnliche und berauschende Rest-Adventszeit!

BRIGITTE 25/2021
Nie wieder Alkohol?
Ich bin nüchtern, ich bin schüchtern. Auf Partys stehe ich öfter allein in der Ecke.
Small Talk fällt mir schwer. Ich höre genau zu, manchmal bin ich streng, ich lache nicht über jeden Witz, und nach Mitternacht möchte ich ins Bett. Das war mal anders. Ganz anders. Ich trinke seit vier Monaten keinen Alkohol mehr, und mein Leben und ich, wir haben uns ver-ändert. Ich lerne neue, nicht nur angenehme Seiten an mir kennen, ebenso wie an den Menschen, denen ich nunmehr nur noch alkoholfrei zuproste. „Wie langweilig!“, sagen einige, „Wie freudlos!“ oder „Du Arme!“. Man hat Mitleid mit mir. Manchmal habe ich Selbstmitleid.
Mein Leben lang habe ich die Maßvollen beneidet und verachtet. Die sogenannten Genussmenschen, die ein Glas Wein trinken und dann auf Tee umsteigen. Das empfand ich als unerreichbares Ideal, bis mich die Autorin Nathalie Stüben fragte: „Ist es vorbildlich, eine Droge zu konsumieren, ohne abhängig zu werden? Mich hat diese Vorstellung in die persönliche Katastrophe geführt. Es gibt keinen gesunden Alkoholkonsum. In der Wissenschaft ist das längst Konsens – aber auf gesellschaftlicher Ebene ist das Trinken so normal, dass es als krank gilt, wenn man es nicht tut.“
Tatsächlich muss ich mich ständig für mein Nichttrinken rechtfertigen. Dass ich kein Schweinefleisch esse, wird akzeptierend und meist wohlwollend zur Kenntnis genommen, ohne dass mir mangelnde Lebensfreude unterstellt wird – aber dass mein Weinglas leer bleibt, empfinden nicht wenige als persönlichen Affront. Weil ich nüchterne Zeugin ihrer eigenen Trunkenheit werde? Oder weil ich aus ihrer Sicht ein paar Promille brauche, um zu der Frau zu werden, mit der sie etwas anfangen können? Ich stelle fest, dass Nichttrinken eine weittragende, existenzielle Entscheidung und Erfahrung ist. Eine Bereicherung und auch eine Belastung, denn wenn der Blick klarer wird, sieht nicht unbedingt alles besser aus. Inklusive man selbst.
Natalie Stüben hat vor fünf Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken, und darüber ein bewegendes Buch geschrieben: „Ohne Alkohol. Die beste Entscheidung meines Lebens“. Sie sagt: „Meistens ist es nicht ein Problem, das zur Alkoholabhängigkeit führt, sondern der Alkohol führt zu den Problemen. Ich habe Jahre damit verplempert, nach einem Grund für meinen Alkoholismus zu suchen, bis mir klar wurde: Erst als ich anfing zu trinken, begannen meine Selbstzweifel, meine Gereiztheit, meine Ohnmacht. Der Alkohol hat nichts anderes getan, als seinen Job erledigt: mich süchtig zu machen.“
Warum ich nicht mehr trinke, möchte Nathalie Stüben von mir wissen. Es ist ein Experiment, dem Weichzeichner Alkohol zu entsagen und den Blick scharf zu stellen. Weil es für mich zum Erwachsenwerden gehört, mich und andere nüchtern zu betrachten, Herrin im eigenen Haus zu sein und mein Schicksal, auch nicht stundenweise, dem Alkohol zu überlassen. Weil Abstinenz nicht viel mit Verzicht zu tun hat. Weil ich kein Mitleid brauche und auch keinen Applaus. Weil ich mich selbst manchmal langweilig finde, wenn ich statt „Prost“ mal wieder „Gute Nacht“ sage. Und weil ich damit leben kann, mal besser und mal schlechter. Mal sehen, wie lange.

BRIGITTE 24/2021
Die Frauen unseres Lebens
Als Kind hießen meine Heldinnen Batman, Winnetou, Papa und Arpad, der Zigeuner. Ich wollte wie ein Junge aussehen und sein, ich spielte Fußball, schlug mir stolz die Knie blutig, jagte Hasen mit Pfeil und Bogen, war Krieger und Häuptling, Räuberhauptmann und Pirat. Immer König. Niemals Prinzessin. Wenn ich groß bin, wollte ich wie ein Mann sein. Mutig, stark und stolz. Denn das waren, aus meiner damaligen Sicht und Erfahrung, typisch und ausschließlich männliche Eigenschaften.
Mich umgaben leider wenige starke und selbstständige Frauen. Die meisten froren im Schatten von Männern und von Konventionen, die von ihnen Zurückhaltung und Selbstaufgabe erwarteten. Sie hatten nicht den Raum, sich zu entfalten, und nahmen für sich nicht das Recht in Anspruch, ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen auszurichten. Erfüllung war Luxus, Glück galt als unschicklicher Prunk. Nur nicht für meine intensive, großartige Tante Hilde, die ihr Leben lang alleinstehend gewesen war und alle Männer in ihrer Nähe eingeschüchtert hatte. Und die meisten Frauen auch. Mich nicht. Ich habe sie geliebt und empfand seit jeher und bis heute große Achtung und Zuneigung gegenüber den unbequemen, unkonventionellen, streitlustigen und stets etwas zu lauten Frauen.
Langsam gibt es immer mehr von ihnen. Frauen treten aus dem Schatten und werden zu Heldinnen. Zu Idolen. Wegbereiterinnen. Vorkämpferinnen.
Die Autorin Anne Amerie-Siemens hat sich in ihrem jetzt erschienenen, großartigen Buch „Die Frauen meines Lebens“ in Interviews mit unterschiedlichsten Gesprächspartnerinnen auf die Suche gemacht nach deren weiblichen Vorbildern, nach prägenden, starken Frauenfiguren. Müttern, Freundinnen, Chefinnen, Schwestern. „Was Heldinnen verbindet, ist, dass sie es als Stärke empfinden, Schwäche zu zeigen“, sagt Anne Amerie-Siemens. „Sie müssen nicht laut sein, um gehört zu werden. Sie müssen nicht immer recht haben, um Erfolg zu haben. Sie wissen, dass Kommunikation, Vielfalt, offener Austausch und das Teilen von Erfahrungen Grundvoraussetzungen für Wachstum sind. Wir alle sind unter den wertenden Blicken von Männern aufgewachsen. Heute müssen und dürfen wir uns davon lösen, Männern gefallen zu wollen. Wir müssen Prozesse des Nachdenkens anstoßen, Frauenfragen stellen, zum Wandel beitragen und selbst zu Vorbildern und Wegbereiterinnen werden.“ Ihre Heldin, sagt sie, war ihre Mutter, die immer an ihrer Seite war, ohne sich aufzudrängen. Nähe ohne Bevormundung, nach dem Grundsatz: „Du darfst anders sein als ich.“
Meine Heldin bin ich.
Für meine Söhne und für mich selbst.
Ich schaue in den Spiegel und sehe ein Vorbild: mutig und ängstlich, stark und schwach, stolz und verzagt.
All das, was ich immer werden wollte. Typisch Frau.

BRIGITTE 23/2021
„Es liegt eine Magie darin, immer wieder alles infrage zu stellen."
Muss das so sein? Muss das so bleiben? Sind andere Lösungen, sind neue Wege denkbar? Diese Fragen sollten uns auf Schritt und Tritt begleiten. Erst durch den Zweifel an dem, was wir für selbst-verständlich halten, entstehen Freiheit, Wachstum und Raum für erfüllende Veränderung. Diesen Raum zu schaffen und zu finden ist keine leichte Aufgabe. Normvorstellungen, auch und besonders die im eigenen Kopf, müssen radikal angegangen und die eigenen Bedürfnisse erkannt, formuliert und durchgesetzt werden. Nicht ohne Rücksicht auf Verluste, aber ohne Rücksicht auf Klischees.
„Es liegt eine Magie darin, immer wieder alles infrage zu stellen,“ sagt Stefanie Luxat, Chefredakteurin und Gründerin des großartigen Blog-Magazins OhhhMhhh.de – und tut es gekonnt und ständig. Während der Corona-Zeit legte sie sich gleich mit zwei bürgerlichen Standards an: dem Ehebett und dem Esszimer. „Mein eigener Raum schrumpfte immer mehr zusammen. Mit zwei kleinen Kindern und einem Ehemann, der nur in der stabilen Seitenlage das Schnarchen einstellt, wusste ich nicht mehr, wohin mit mir. Ich war unfassbar erschöpft. Schließlich habe ich meine Wünsche auf-gespürt und ausgesprochen, meinen Kopf von gesellschaftlichen Normen frei- und das Esszimmer ausgeräumt.“ Jetzt hat sie ein eigenes, kleines Zimmer mit Bett und Schreibtisch. Zwölf Quadratmeter Freiheit. „Es geht nicht nur um den physischen Raum, es geht im übertragenen Sinne darum, all den Raum einzunehmen, den man gern für sich hätte. Das halten viele für gefährlich,“ sagt Stefanie Luxat und macht mit dieser Einstellung und ihrer Werbung für gesunden Egoismus gern mal Frauen hellhörig und Männer nervös. „Die fürchten, dass ich ihre Partnerin auf falsche Ideen bringe und sie womöglich demnächst auch mal die Wäsche machen müssen. Ich glaube, das Beziehungen nur funktionieren, wenn man sich gemeinsam weiterentwickelt und eingefahrene Muster immer wieder korrigiert.“
Dazu gehören Mut und Fantasie, Abenteuerlust und eine innere Haltung der Offenheit. Jedes Leben ist in weiten Teilen fremdbestimmt, aber oft geben wir mehr Mitbestimmungsrecht auf als nötig, lassen uns einschüchtern von angeblich erprobten Strukturen, angeblich festgemauerten Wänden, angeblich sinnvollen Regelungen. Natürlich hat nicht jede Frau zwölf Quadratmeter übrig und ein Esszimmer gehört keineswegs zur Grundausstattung. Aber in unseren Köpfen gibt es unbegrenzten Raum. Raum für Rückzug und Stille. Für Kreativität und Selbstfür-sorge.
Für Abschied und für Neubeginn.
Für die gewagte Frage: „Muss das so bleiben?“
Und für die gewagte Antwort:
„Nein!“

BRIGITTE 22/2021
Was uns zu besseren Menschen macht
Es ist ganz normal, dass man immer die anderen für verrückt hält. Als ich noch keinen Hund hatte, spottete ich ohne Hemmungen über durchgeknallte Hundebesitzer, die mit Hundedecke und Hundespielzeug in hundefreundliche Hotels verreisen, an Hundestränden liegen und sonntags Hundekuchen backen.
Seit Hilde, ein Mini-Golden-Doodle- Mädchen, in mein Leben trat, sehe ich die Sache naturgemäß anders. Differenzierter, würde ich sagen. Ich verstehe jetzt die unaufgeregte Liebe zu einer Begleiterin, die mich nie verurteilt, allein durch meine Anwesenheit zufriedenzustellen ist, und die es mir nicht übel nimmt, wenn ich sie zwei Stunden im Keller vergesse, sondern sich im Gegenteil freut wie ein Schnitzel, wenn ich mich endlich panisch und schuldbewusst an sie erinnere. Keine Vorwürfe. Stattdessen pures Glück. Man stelle sich eine vergleichbare Situation mit einem Ehemann oder einem pubertierenden Sohn vor. Vorwürfe ohne Ende. Liebesentzug. Drama pur.
Es sind viele kleine, rührende und manchmal tragische Liebesgeschichten zwischen Menschen und ihren Hunden – und eine davon erzählen Christina Schenk und Denis Scheck in ihrem jetzt erschienenen Buch „Ein undogmatischer Hund“. Die Journalistin und der Literaturkritiker sind verheiratet, leben seit zwölf Jahren mit dem Foxterrier Stubbs zusammen und sind Experten in der intellektuellen Durchdringung des Themas Hundebeziehung.
„Wir haben uns die Entscheidung für einen Hund schwer gemacht, zwei Jahre darauf rumgekaut. Die Tierheime sind voll von Hunden, deren Besitzer sich die Entscheidung zu leicht gemacht haben. Ein Hund ist nicht Teil des Fun-Angebots unserer Freizeitgesellschaft. Er ist eine Aufgabe und ein Schicksal. Er wartet darauf, dass wir ihm entsprechen. Und dann ist er ein großes Glück, ein Seelengefährte, der immer auf deiner Seite ist und dich immer toll findet, was man von einem Partner ja nicht behaupten kann“, sagt Christina Schenk. „Der Hund schweißt meinen Mann und mich zusammen, wie alles was man gemeinsam liebt. Stubbs macht uns zu besseren, rücksichtsvolleren Menschen.“
Kurze Zwischenfrage an den Berufskritiker Denis Scheck: „Hat der Hund Sie zu sehr gezähmt?“ Das sei eine unbegründete Sorge, beruhigt er mich. „Ich habe durch ihn gelernt, meine Aggressionen wohldosiert einzusetzen.“
Ich betrachte mein schlafendes Hundemädchen Hilde. Sie zwingt mich, immer wieder innezuhalten, tief durchzuatmen und zu bemerken, dass es draußen Herbst wird und die Luft nach reifen Äpfeln riecht.
Alles um uns herum ist komplex, schwierig, schnell und atemlos – da ist es ein Glück fürs Seelenheil, ein Wesen zu streicheln, das immer ein Grad wärmer ist als du.

BRIGITTE 21/2021
Es gibt für jeden Menschen den richtigen Platz
Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich, wie die Landschaft mehr und mehr Formen annimmt. Ich erkenne ein paar Einzelheiten: eine Scheune, ein paar Kühe, am Horizont ein Kirchturm, viel-leicht zieht dort gerade ein Gewitter auf. Manchmal verringert sich das Tempo des eigenen Lebenszuges und aus dem alltäg-lichen Dahinbrausen wird ein kontemplatives Bummeln. Langsamfahrstelle.
Zeit für eine Bestandsaufnahme und dafür, den Weg, auf dem man sich befidet, infrage zu stellen. Schwellensituationen im Leben werden manchmal durch Krisen oder Schicksalsschläge hervorgerufen, meist aber schlicht durch des Daseins Gang, der einen immer wieder in Phasen des Übergangs führt. Nach dem Schulabschluss, vor der ersten beruflichen Entscheidung, wenn die Kinder groß werden, wenn das Leben in die Jahre kommt. Tempolimits an Hochgeschwindigkeitsstrecken. Innehalten, orientieren. Weichen neu stellen. Weiterfahren oder am nächsten Bahnhof aussteigen?
Ragnhild Struss ist eine Wegweiserin an den Haltestellen des Lebens. In ihrem Unternehmen für Berufs- und Karriereplanung hilft sie bei der Beantwortung der elementaren Frage: Wo ist mein ganz eigener Weg?
„Erlauben Sie sich ein Gedankenspiel: Was würden Sie tun, wenn weder Angst, Geld noch die Meinung anderer eine Rolle spielen würden?“, sagt Ragnhild Struss. „Betrachten Sie Ihre bisherige Reise und geben Sie sich die Erlaubnis, sich die Frage nach der weiterführenden Selbstentfaltung überhaupt zu stellen! Passt Ihr geführtes Leben noch zu Ihrem Innenleben? Wie können Sie Ihre Lebenssituation Ihren derzeitigen Bedürfnissen anpassen? Orientieren Sie sich dabei von innen nach außen. Nicht umgekehrt! Fragen Sie sich nicht, was Ihnen fehlt, sondern was Sie bereits haben und weiterentwickeln möchten. Wo liegen Ihre Stärken? Die Wahrscheinlichkeit, dass man eigene Talente übersieht, ist groß, weil sie einem normal vorkommen und weil man sich selbst oft zu kritisch sieht. Betrachten Sie sich selbst so liebe-voll wie Ihre beste Freundin.“
Wege zu finden, ist ja schon schwer genug.
Aber Wege zu verlassen kann noch viel schwerer sein. „Veränderung braucht Mut,“ sagt Ragnhild Struss. „Es ist nie zu spät, den eingeschlagenen Weg zu verlassen. Das heißt nicht, dass er falsch war. Er ist nur zu Ende.“ Ich mag die Langsamfahrstrecken in meinem Leben.
Wenn ich danach wieder Tempo aufnehme, bin ich vielleicht in einer anderen, aber auf jeden Fall wieder in der richtigen Richtung unterwegs.

BRIGITTE 20/2021
Das, was eigentlich nie passiert
Diese Geschichte beginnt mit dem Tod von Oskar. Er hatte bei seinen Großeltern übernachtet, sein Opa fand ihn morgens leblos im Bett. Als sich die Mutter zu ihrem toten Kind legte, war sein Körper noch warm. „Das Leben verschwand allmählich aus ihm. Für mich war es wichtig, diesen Übergang begleiten und mich, mit meinem Sohn in den Armen, von ihm verabschieden zu können.“ Sie ertrug kein Mitleid und keine Berührungen. „Das hätte meinen Schmerz entwertet.“ Nur mit Oskars Vater fühlte sie sich in dieser Stunde null verbunden, der Vater, der, wie sie, nie wieder derselbe Mensch sein würde.
Als Oskar in der Nacht zum 1. September vor zwei Jahren starb, hatten seine Eltern Iris und Johann Killinger keine Ahnung von dem tödlichen Risiko, mit dem ihr Sohn gelebt hatte. „An Epilepsie stirbt man nicht“, hatte ihnen sein Arzt versichert und sie damit beruhigt. Sogar noch nach Oskars Tod sagte er: „Kinder wie Oskar sterben nicht an SUDEP.“
SUDEP, das, was eigentlich nie passiert, ist der plötzliche Epilepsietod, Sudden Unexpected Death in Epilepsy, und er passiert allein in Deutschland mindestens zweimal am Tag. „Das sind viele“, sagt Iris Killinger. „Trotzdem ist es das Standardverhalten von Ärzten, ihre Patienten nicht über SUDEP aufzuklären. Dabei könnten bis zu 70 Prozent der Todesfälle vermieden werden.“ Mit Oskars Vater hat sie eine Stiftung gegründet, die Betroffene und Ärzte über das SUDEPRisiko und die Möglichkeiten, es zu reduzieren, informiert. Zu spät für Oskar. Aber vielleicht noch rechtzeitig, um das Kind einer anderen Mutter zu retten.
Meine Freundin Iris hat oft daran gedacht, ihrem Sohn nachzusterben. Der Gedanke, nicht unter allen Umständen weiterleben zu müssen, hat sie getröstet. Ein halbes Jahr nach Oskars Tod wurde sie schwer krank und musste operiert werden. Als der Beatmungsschlauch nach dem stundenlangen Eingriff entfernt werden sollte, spürte sie, dass sie noch nicht allein atmen konnte. Sie hatte Todesangst. Und einen Überlebenswillen, der stärker war als die Trauer über den Tod ihres einzigen Kindes.
Iris ist vor wenigen Monaten wieder Mutter geworden. Ihr Glück ist groß, aber es wird nie wieder pur sein, sondern durchzogen von Rissen und Brüchen, stets vermischt mit Trauer, es ist tief und immer relativ.
Diese Geschichte beginnt mit dem Tod von Oskar.
Aber sie endet nicht mit seinem Tod.
Seine Mutter sagt: „Irgendwann werde ich bei ihm sein.
Und bis dahin will ich leben.“

BRIGITTE 19/2021
Entfolgt euch!
Nachdem ich vor zwei Jahren großspurig und vollmundig meinen Abschied von Instagram verkündet hatte, um mich ganz auf die analoge Wirklichkeit zu konzentrieren, bin ich zwischenzeitlich kleinlaut in die Welt des Postings und Posings zurückgekehrt. Irgendwie hatte ich den Eindruck, einen Schnellzug zu verpassen und meine digitale Zukunft aufs Spiel zu setzen. Jetzt allerdings frage ich mich nahezu täglich, wie es möglich sein soll, glücklich verheiratet zu sein, wenn man Heidi Klum folgt, warum ich den blauen Haken für Prominente bei Instagram nicht bekomme, und wie mir in den sozialen Medien die Gratwanderung gelingen soll zwischen persönlich und zu privat, zwischen Filter und Falten.
Elena Carrière ist Model und Influencerin mit einer halben Million Follower, und selbst ihre Mutter hat Probleme, ihren Freundinnen zu erklären, was ihre Tochter beruflich genau macht. Nachdem Elena vor fünf Jahren Zweitplatzierte bei „Germany’s Next Topmodel“ wurde, fühlte sie sich „reingeschmissen in das Haifischbecken der sozialen Medien. Ich habe einfach mitgemacht, ohne mich zu fragen, was das in mir und meinen Follo-wern auslöst, ob und wie ich sie beeindrucke, beeinflusse und vielleicht auch beeinträchtige. Heute gelingt es mir bes-ser, mich zu distanzieren, nicht jeden Kommentar persönlich zu nehmen und mich nicht von der Zahl meiner Follower abhängig zu machen. Sie kommen und sie gehen. Ich nehme das nicht mehr persönlich. Ich will nicht mehr jeden erreichen und bin radikaler geworden. Ich folge Leuten nicht mehr, die mir ein schlechtes Gefühl geben, und ich kann nur jeden und jede umgekehrt ermutigen: Entfolgt mir, wenn ich euch nicht guttue!“
Und trotzdem – was für eine Erleichterung – gelingt es auch ihr, der Profi-Posterin, nicht immer, sich von destruktiven Vergleichen freizumachen. „Ich weiß, dass alles poliert ist“, sagt Elena.
„Trotzdem tappe ich selbst immer wieder in die Falle und frage mich missmutig, warum Pamela Reif immer so perfekt aussieht.“
Die Pamela kenne ich nicht, und mein Interesse an Perfektion ist gering. Als mir neulich jemand auf Facebook schrieb
„Dein Leben ist ein Märchen!“, war ich tief getroffen. Mein Leben ist kein Märchen, und den Eindruck will ich unter keinen Umständen vermitteln. Muss ich mehr Tiefpunkte posten, den Filter weglassen, Ängste, Sorgen und Zweifel teilen? Aber wer will sie sehen, die unbearbeiteten Fotos meines Alltags? Büro, Schmutzwäsche, Vokabeln abfragen, Nägel schneiden, Beißschiene.
„Ich bin nicht perfekt“, postet Elena Carrière fast trotzig gegen ihre eigene Makellosigkeit an. #justbeyou, leicht gesagt, denkt man da leicht und vergrämt. „Nur weil andere mich schön finden, muss ich mich selbst nicht schön finden“, sagt Elena. „Weil ich dünn bin, darf ich nicht an mir zweifeln, weil ich Model bin, darf ich nicht unglücklich sein? Ich will inspirieren. Ich will motivieren. Aber vergesst nicht: Ich gehe genauso auf den Pott wie ihr!“

BRIGITTE 18/2021
Das Ende der Kreidezeit
Wann hat für mich der Ernst des Lebens begonnen? Ich würde sagen: definitiv mit der Schulzeit. Der meiner Kinder. Als Mutter zweier Teenager weiß ich, wie wichtig es für den Erhalt einer gewissen Lebensfreude ist, das eigene Seelenheil und den Familienfrieden nicht unmittelbar mit Noten, Klausurergebnissen und den handschriftlichen Bemerkungen des Lehrkörpers am rechten Korrekturrand zu verknüpfen.
Da ich eh nicht rechnen kann, fällt es mir nicht allzu schwer, immer mal wieder fünfe gerade sein zu lassen, und als gebürtiger Rheinländerin steht mir Humor zur Selbstverteidigung zur Verfügung, auch gegen Latein, Shakespeare und den Zitronensäurezyklus. Trotzdem ist mit Zeugnissen, Elternabenden und Lernentwicklungsgesprächen eine neue Ernsthaftigkeit eingezogen, und es gefällt mir nicht, dass mich eine schlechte Note oft mehr beschäftigt als eine gute. Sau blöd. Sowohl pädagogisch als auch fürs Karma.
Der Herr Schröder ist Experte für das Ertragen von Schule. Er war Deutschlehrer und ist aus Notwehr Comedian geworden. Der Autor des sehr lustigen Buches „Instagrammatik“ nennt sich einen „Beamten mit Frustrationshintergrund“ und betrachtet den Schulbetrieb aus sicherer Entfernung, mit großer Kenntnis und freundschaftlicher Distanziertheit. „Wir erleben an den Schulen das Ende der Kreidezeit“, sagt er. „Der uralte Beamtenapparat kollidiert mit dem radikalen, digitalen Wandel. Das starre, föderale Bildungssystem ist den Anforderungen nicht gewachsen. Schulen und Lehrer*innen wird zu wenig erlaubt, Experimente zu wagen und eigene Wege zu gehen, die träge Bürokratie macht unflexibel. Die Wahrheit ist doch: Wir haben keine Ahnung, was in zehn Jahren gewusst werden muss. Warum müssen Schüler*innen bei Prüfungen noch die Tische auseinanderschieben in einer Welt, in der es um Teamarbeit geht? Warum muss während Klausuren das
Handy weggelegt werden, wo sonst stänDig Wissen für alle auf Knopfdruck zur Verfügung steht? Jede einzelne Note zementiert dieses anachronistische System. Wir brauchen alternative Formen der Leistungsmessung.“
Aber bis auf Weiteres gilt noch: Das nächste Zeugnis kommt bestimmt. Wie kommt man unbeschadet durch die Schulzeit der eigenen Kinder? Wie kann man sie motivieren und trösten? Sie sollen die Schule ernst, aber eine schlechte Note wiederum nicht zu schwer nehmen. Ziemlich knifflig.
„Unser Leben ist durchtränkt von Bewertungen und Vergleichen“, sagt Johannes Schröder. „Man sollte sich selbst befragen: Bin ich ein Beurteiler geworden? Man sollte seinem Kind Wertschätzung statt Bewertung vorleben und entgegenbringen und sich selbst und ihm immer wieder klar machen: Du bist nicht dein Zeugnis.“
Vielleicht noch ein Tipp to go fürs Zusammenleben mit Teenagern? „Tun Sie Ihren Söhnen einen Gefallen und zücken Sie nicht die große Waffe der Sorge, sondern ermöglichen Sie ihnen eine gründliche Pubertät.“
Gründlich? Na dann. Augen zu.
Und durch.

BRIGITTE 17/2021
Blasser Penis vor unaufgeräumtem Zimmer
Kommunikation als solche birgt ja ohnehin schon viele Tücken. Kommunikation zwischen Mann und Frau ist ein Spezial-fall und besonders störanfällig. Können sich die beiden beim Kommunizieren dann auch noch weder sehen noch hören, ist es nicht verwunderlich, dass Missverständnisse, zerbrochene Beziehungen und zerbrochene Herzen vorprogrammiert sind. Kurznachrichten sind der kürzeste Weg zu Tragik, Peinlichkeit, Absurdität und oft genug völlig unfreiwilliger Komik.
Die Autorinnen Anika Decker und Katja Berlin haben es sich in ihrem gerade erschienenen Buch zur Aufgabe gemacht, Nachrichten von Männern zu analysieren, zu kategorisieren und mit sehr hilfreichen Ratschlägen zum Umgang mit unangenehmen Textern aus den Gattungen Ghoster, Dickpicer, Klette, Herrklärer, ekelige Sexter, Zombies und Chatsetter zu versehen. „Nachrichten von Männern“ ist in erster Linie sehr lustig. Und in zweiter Linie durchaus tragisch. Denn all diese Nachrichten von Männern sind Nachrichten an Frauen, die sie lesen, damit umgehen, darüber hinweggehen, die sie verdauen und verkraften müssen. Die Möglichkeit und die Versuchung, sich daneben-, schlecht, unangemessen, feige oder verletzend zu benehmen, ist durch die Erfindung von Kurznachrichten dramatisch gestiegen.
Anika Decker hat in ihrem Leben schon sehr viele unheimlich peinliche Nachrichten bekommen und verschickt (Wer nicht? Ich habe mich bereits im Zeitalter des Analogen per Post, per im Unterricht weitergereichter Zettelchen und am Telefon grotesk entwürdigt) und kennt die Versuchung, den Weg der indirekten Kommunikation und damit des geringsten Widerstands zu gehen. „Ich muss mich manchmal mit Gewalt zurück- halten, keine bequemen, halbseidenen Nachrichten, Absagen oder Entschuldigungen zu verschicken. Oder mich gar nicht zurückzumelden. Das ist stillos und beschissen. ‚Ghosting‘ ist quasi die Jog-ginghose unter den Schlussmacharten.“
Und wie erträgt man das als leid-tragende Nachrichtenempfängerin oder eben Nichtempfängerin? „Es kann sehr tröstlich für Frauen sein, zu wissen, dass sie kein Einzelfall sind“, sagt Anika Decker. „Wir sind alle schon geghostet worden und haben unzählige eklige, kleinmachende, besserwisserische Nach-richten oder Fotos von blassen Penissen vor unaufgeräumten Zimmern bekommen. Man fragt sich: Gibt es eine Welt, in der Frauen sich darüber freuen, wenn sie ein Dickpic bekommen? Nein, die gibt es nicht, und abgesehen davon ist es strafbar und kein Kavaliersdelikt.“
Was würde wohl im Buch „Nachrichten von Frauen“ stehen – abgesehen davon, dass wir, mangels Dick, auch niemanden mit entsprechenden Fotos belästigen könnten, und unsere Zimmer meist aufgeräumter sind?
„Das Buch“, sagt Anika Decker mit Überzeugung, „wäre genauso peinlich.“

BRIGITTE 16/2021
Der Mann des Lebens
Es ist noch nicht allzu lange her, da hatte ich eine vollkommen andere Kindheit. Sonnig und problemfrei. Meine Eltern waren nahezu perfekt, und insbesondere an meinem Vater hatte ich wenig auszusetzen. Jetzt ist mein Vater ein anderer Mensch, weil er ein Mensch geworden ist. Unsere Beziehung zueinander ist reifer, sie ist gewachsen, weil ich ausgewachsen bin. Es gibt kein Gefälle mehr zwischen uns, wir begegnen uns als Erwachsene, und ich habe ihn von dem Sockel geholt, auf den ich ihn gestellt hatte. Dabei ist mein Vater zerbrochen, in viele Teile, die ich mühsam, sorgfältig und neu zusammengesetzt habe. So wurde er, 25 Jahre nach seinem Tod, vom fehlerfreien Idol zur komplexen Persönlichkeit, und ich vollzog einen entscheidenden Schritt zum Erwachsenwerden. Ziemlich spät.
„Nein“, sagt Susann Sitzler, Autorin des Buches „Väter und Töchter“, dass ich mit großem Erkenntnisgewinn und großer Ergriffenheit gelesen habe. „Sich vom Idealbild des Vaters zu lösen, gelingt Töchtern oft erst in der Lebensmitte. Dann haben sie die Kraft, den Mut und auch das Interesse, sich die Deutungshoheit über den eigenen Vater anzueignen, Widersprüchen auf den Grund zu gehen, dem Vater als Menschen gerecht zu werden und auch sich selbst. Wenn die Wahrnehmung und damit die Bewertung von Männern allmählich nachlässt, wird vielen Frauen plötzlich klar, was dieser männliche Blick für eine Bedeutung hatte, und wie prägend der eigene Vater dabei war. Das kann das eigene Fundament erschüttern, aber als erwachsene Tochter trägt man die Verantwortung für sein Glück allein. Man muss aushalten lernen, dass der Vater Schwächen hat, vielleicht muss man Abstand von ihm nehmen, vielleicht entdeckt man unvermutete Stärken. Wir Töchter müssen uns damit abfinden, dass es für diesen Mann und für keine seiner Eigenschaften je einen wirklichen Ersatz geben kann.“
Und vor allem müssen wir uns klar-machen: Wir brauchen keinen Vaterersatz! Zur Emanzipation gehört, dass man nicht nach dem vertrauten, bekannten Unglück oder auch Glück sucht, sondern sein Leben in Besitz nimmt und sein eigenes Schicksal erschafft. Den Vater zu vermenschlichen ist kein einfacher, ein oft schmerzhafter und, wie ich vermute, lebenslanger Prozess. Dazu gehört, sich dazu durchzuringen, erwachsen zu werden und nicht mehr gefallen zu wollen. Die Blickrichtung und den Blickwinkel zu verändern. Nicht mehr aufschauen, sondern anschauen. Sich versöhnen, eventuell mit dem Vater, aber in allererster Linie mit sich selbst.
Wir treten nicht in Fußstapfen, wir hinterlassen unsere eigenen Spuren.
Wir bleiben Töchter unser Leben lang, aber wir sind schon lange keine Kinder mehr.

BRIGITTE 15/2021
Barfuß im Wald
Mikroabenteuer. Das Wort ist wie für mich gemacht. Es ist ein Wort für Zaudernde und Furchtsame.
Es nähert sich vorsichtig und ehrfurchtsvoll dem gro-ßen Begriff vom „Abenteuer“ an. Es nimmt ihm das Fordernde und Überfor-dernde, es macht Mut, etwas zu erleben, ohne gleich befürchten zu müssen, im Dschungel, in einer Gletscherspalte oder in den Weiten einer Wüste verloren zu gehen. Mikroabenteuer sind dafür gedacht, den Alltag interessanter zu machen, ohne ihm gleich komplett entfliehen zu müssen. Man braucht weder einen Plan noch Geld, nur ein kleines bisschen Mut, und der Pegel der Sehn-sucht nach etwas Neuem muss den der Lust am Gewohnten lediglich um einen Fingerbreit übersteigen.
Der Experte für diese kleinen Freiheiten heißt Christo Foerster. Vor ein paar Jahren entschied er, spontan über Nacht mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin zu fahren, um dort mit einem alten Freund zu frühstücken.
„Seither lässt mich das kolossal unterschätzte Potenzial der kleinen Abenteuer nicht mehr los“, sagt der Mann, der inzwischen die Motivationsplattform „Raus und machen“ gegründet, einen Podcast gestartet und zwei sehr ermutigende und lehrreiche Bücher zum Thema geschrieben hat.
Während ich noch nach einer sauberen Unterkunft mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis recherchiere, hat Christo Foerster schon seine Hängematte zwischen zwei Bäume gespannt, ist einem Fluss von der Quelle bis zur Mündung gefolgt oder verbringt die Mittsommernacht mit Blick auf den Hamburger Hafen. „Ein Abenteuer ist nicht einfach ein Ausflug in die nähere Umgebung. Das Abenteuer liegt da, wo die Angst ist. Es ist ein Wagnis mit ungewissem Ausgang, nicht durch-geplant, nicht gebucht. Ohne Mut kein Abenteuer. Aber was mutig ist, bestimmt jeder für sich selbst.“
„Haben Sie eventuell auch ein paar Tipps für eingefleischte Angsthasen?“, bitte ich zaghaft um Auskunft und würde am liebsten, wenig glaubwürdig, hinzufügen: „Ich frage für eine Freundin.“
„Der erste Schritt vor die Tür ist der schwerste“, sagt der Offroad-Experte. „Suchen Sie sich ein Wagnis, das zu Ihnen passt. Gehen Sie zu Fuß zur Oma, verbringen Sie eine Nacht in Ihrem Garten, erleben Sie eine Woche lang den Sonnenaufgang draußen, gehen Sie einfach los und lassen Sie an jeder Straßenecke die Würfel entscheiden, wo Sie abbiegen. Stellen Sie sich einen kleinen, stets gepackten Rucksack in den Flur, sodass Sie jederzeit aufbrechen können. Sie werden mit jeder Herausforderung wachsen. Es wird nicht immer bequem sein und nicht immer Spaß machen – aber Sie werden voller Stolz und voller Energie sein. Sie werden sich frei fühlen.“
Ich mag den Gedanken sehr, mein Leben durch alltägliche, kleine Selbstüberwindungen dem Strom der Gleichförmigkeit zu entreißen. Isomatte statt Boxspringbett. Verkehrsinsel statt Gran Canaria. Wagen statt buchen, barfuß im Wald statt in Pantoffeln vor dem Fern-seher. Sonnenaufgang statt Tageslichtwecker. Machen statt träumen.
Jetzt statt irgendwann.

BRIGITTE 14/2021
Wertvolle Löcher in meinem Kopf
Sie sind die Vorzimmerdamen des Gehirns und unterschätzte Helden: Rachen, Nase und Ohren. Was man mit ihnen tun sollte – und was lieber nicht.
Es war mein Onkel Hansgert, der mir ein frühes Nasentrauma bescherte. „Das ist lebensgefährlich“, drohte er mir, als ich mal wieder mit schleimigem Getöse das Nasensekret, das wir selbstverständlich „Rotz“ nannten, hochzog, statt ein Taschentuch zu benutzen. „Sobald der Kopf voll ist, fällst du tot um.“
Jetzt gelang es einer freundlichen Fachfrau, mich mit wenigen Worten von meiner Urangst zu befreien. „Rotz kann niemals ins Gehirn gelangen, Corona- Teststäbchen übrigens auch nicht. Das Sekret fließt nach unten durch den Rachen in den Magen. Es müsste also eigentlich nicht ‚Nase hochziehen‘, sondern ‚runterziehen‘ heißen“, sagt Dr. Christine Löber, Fachärztin für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. „Und falls Sie sich fragen, ob Popeln ungesund ist, kann ich Sie auch dahingehend beruhigen. Aber Finger weg von Q-tips! Manche Menschen betreiben damit regelrechten Ohrensex. Das ist ungesund. Die Ohren reinigen sich von alleine und Ohren-schmalz ist ein super Zeug, dass den Gehörgang vor Eindringlingen schützt!“
Das ist erleichternd und gut zu wissen. Dr. Löber hat, zusammen mit der Journalistin Hanna Grabbe, das witzige und super interessante Buch „Immer der Nase nach“ geschrieben. Sie berichten darin vom Schicksal unserer heldenhaften Nase, die sich nie dem Geschehen entzie-en kann, die Gefühle riecht und uns zu manipulierbaren Trotteln macht. Dr. Löber selbst hätte einmal beinahe eine überteuerte Bruchbude gekauft, bloß weil der geschickte Makler in dem Haus vor-her einen Apfelkuchen gebacken hatte.
Ich wiederum denke bei „Azzaro pour homme“ an meinen ersten Freund Stephan und gebe jedem danach riechen-den Mann bis heute einen törichten Vertrauensvorschuss. „Vanille“, sagt Dr. Löber, „ist die Fahrstuhlmusik unter den Düften. Den findet ein Großteil der Men-chen angenehm.“ Weiter erklärt sie mir, warum Schlucken lebensgefährlich ist, was Liebe mit Achselschweiß zu tun hat, warum man eine Erkältung nicht von Kälte bekommt und warum sie mit ihrer tiefen Stimme eigentlich längst Kanzlerin sein müsste. „Menschen mit einer tiefe-ren Stimme wird mehr Kompetenz zugesprochen. Die Tonlage der Frauen ist in den letzten Jahrzehnten insgesamt runtergegangen. Nicht wegen einer Veränderung des Kehlkopfes, sondern mit fort-schreitender Emanzipation. Wir finden endlich allmählich unsere eigentliche Stimme. Das hohe Hauchen passt nicht mehr zum modernen Frauenbild. Auch die Stimme von Angela Merkel hat sich in den letzten Jahren verändert, ist ruhiger und tiefer geworden.“
Meine Stimme ist eigentlich auch recht tief. Fast kanzleramtstauglich. Es sei denn, ich schreie rum, weil ich in einem Schulranzen ein Pausenbrot entdeckt habe aus Zeiten, als Corona noch aus-schließlich eine Biersorte war. „Hohe Stimmen werden weniger ernst genommen“, sagt Dr. Löber bedauernd.
Ich werde mich in Zukunft auf ein tiefes, bedrohliches Brummen verlegen.
Und beim Durchsuchen der Schulranzen die Luft anhalten.
Ich sehe meine Nase jetzt mit ganz anderen Augen.

BRIGITTE 13/2021
„Nein ist ein vollständiger Satz!“
er „Ja“ sagt, kann auch Nein meinen. Ich weiß, dass im raschen Takt der täglich von mir geforderten und erforderlichen Antworten längst nicht jedes „Ja“ aus vollem Herzen kommt. Gerade beim Zusammenleben mit Heranwachsenden mit heranwachsendem eigenen Willen fühle ich mich einem Trommelfeuer an Forderungen ausgesetzt. Ein Orkan an Fragen, ein Aktionszyklon, der nach meiner schnellen Reaktion verlangt, nach klaren, durchdachten Antworten.
Da schafft das schnelle „Ja“ kurzfristig Erleichterung. Aber wie alles Halb-herzige im Leben, verstopfen einem auch die bequemen, aber falschen „Ja“ die Arterien und verringern die Sauerstoffzufuhr zu Hirn und Herz. „Nichts ist anstrengender, als nicht man selbst zu sein“, sagt Annette Lies, die Autorin des packenden Buches „Nein ist meine Superkraft“.
Allerdings ist es auch anstrengend, man selbst zu sein. Denn Nein zu sagen bedeutet, sich die eigenen Grenzen bewusst zu machen, sie zu schützen und die Reaktionen des Gegenübers auszuhalten – im besten Fall sogar ohne ein schlechtes Gewissen. Die „Nein“- Schwäche ist, ähnlich der Bindegewebsschwäche, bei Frauen verbreiteter als bei Männern. Das liegt an so durchaus wertvollen weiblichen Tugenden wie der Bereitschaft zum Geben, zum Teilen, zur Diplomatie und Selbstkritik, aber auch an der häufig früh vermittelten Attitüde des sittsamen Veilchens, das, anders als die stolze Rose, bescheiden, gefällig und ohne Dornen zu sein hat. Nein zu sagen heißt, die Krallen
auszufahren und mehr an sich selbst als an andere zu denken. Das ist nicht egoistisch, sondern das ist selbstbewusst.
„Unser Nein stärkt unser seelisches Immunsystem“, sagt Annette Lies.
„Das Nein ist die Wahrheit über mich selbst, es wächst mit seinen Aufgaben, mit jedem Nein übernehme ich Eigenverantwortung, verteidige meine Lebenszeit. Das Nein ist mein bester Freund geworden. Ich nehme mir Zeit für adäquate Entscheidungen und lasse mich nicht drängen. Nein ist nicht nur ein Wort, es ist ein Weg.“
Es lebt sich besser, wenn man meint, was man sagt, sich nicht in unnötigen Rechtfertigungen verliert und das Wort „eigentlich“ als einen deutlichen Hin-weis auf innere Unentschlossenheit und Waschlappentum aus dem Wortschatz verbannt. „
Nein ist ein vollständiger Satz“, sagt Annette Lies.
Und das muss man erst mal aussprechen, aushalten und einfach so stehen lassen.

BRIGITTE 12/2021
Die Kunst der Übernächstenliebe
Wenn ich den Mann sehe, bekomme ich sofort ein schlechtes Gewissen. Ich fühle mich nachhaltig daran erinnert, was ich lieber tun und was ich lieber lassen sollte.
Er ist Arzt, Autor, Komiker, Vordenker und imposante Nervensäge: Eckart von Hirschhausen. Während ich selbstzufrieden kundtue, dass ich kaum Fleisch esse, Plastik vermeide und zu Fuß ins Büro gehe, tritt er an, die ganze Welt zu retten. „Mensch Erde!“ heißt sein packendes neues Buch, das die Klima krise deutlich und neue Ideen denkbar macht.
„Ich merke, dass ich anderen Leuten damit auf die Nerven gehe“, sagt Eckart von Hirschhausen. „Aber ich kann Menschen, die meinen, einen SUV zu brauchen, nicht mehr ernst nehmen. Geländewagen ohne Gelände? Jeder so, wie er will – das funktioniert einfach nicht mehr. Corona hat uns deutlich gemacht, dass sich niemand aus der globalen Verantwortung herausstehlen kann: Ein Virus braucht kein Visum, und einem CO2-Molekül ist es auch egal, woher es kommt. Es tut einfach seinen Job und überhitzt die Atmosphäre.“
Ich bin stets sehr und zu Recht beeindruckt von Mitreißern, Vorreitern und Mutmachern, von Menschen mit Mission und Vision, die nicht gefallen, sondern gehört werden wollen. Ich gehöre eher zu denen, die sich mitreißen lassen, die kleiner denken und glauben, man müsse erst selbst alles richtig machen, ehe man Ratschläge oder gar Anweisungen geben darf. Darf ich mich für Tierschutz aussprechen und im Sommer Grillwürstchen essen? Darf ich für die Umwelt und das Klima demonstrieren, wo ich doch damit liebäugele, im Herbst nach Kreta zu fliegen, und die Hosen meiner Kinder eher günstig als
nachhaltig produziert sind? Wie soll ich Vorbild sein, wenn ich oft meinen eigenen Ansprüchen nicht genüge?
„Typisch“, sagt von Hirschhausen energisch, „insbesondere Frauen glauben, sie müssten erst mal bei sich selbst anfangen, um Stellung beziehen zu dürfen. Das halte ich für eine Sackgasse. Je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto ungeduldiger werde ich. Ich muss aufpassen, dass ich meinen Humor nicht verliere. Die Bäume schreien um Hilfe, die Luft ist nicht frisch, und ich frage mich, ob die Leute noch so viel Fleisch essen würden, wenn sie zu jedem Kilo die 20 Liter Gülle dazu bekämen, die dabei erzeugt worden sind.“
Bei aller stiller Verzweiflung, die den lauten Kämpfer manchmal überkommt angesichts der Welt und ihrer Lage, sieht er doch auch einige wenige positive Entwicklungen: Empowerment von Frauen, dass Status sich immer weniger über Ressourcenverbrauch definiert, und eine Art globaler, grenzenloser Empathie. Eckart von Hirschhausen nennt das „Übernächstenliebe“ – die Fähigkeit des Mitgefühls für Menschen, die wir nicht kennen, und für kommende Generationen. Verantwortung für morgen übernehmen: Dafür lohnt es, sich mitreißen zu lassen. Für eine Zukunft jenseits der unseren.

BRIGITTE 11/2021
"Haltet durch!"
Kinder sind ein Glück für Eltern und ein Drama für Paare. Und das ist nicht schlimm.
Es sei denn, es trifft einen unvorbereitet. Denn der erste und wichtigste Tipp für werdende Eltern lautet: Halten Sie durch! Es gibt drei Krisen- Phasen zu überstehen, in der statistisch die meisten Trennungen und Scheidungen passieren. Machen Sie sich zunächst darauf gefasst, sich mit der Geburt Ihres Kindes als Paar aus den Augen zu verlieren und für eine ziemlich lange und anstrengende Zeit nur Eltern zu sein. Und glauben Sie bloß nicht, Sie seien aus dem Gröbsten raus, nur weil Ihr Kind allein aufs Klo gehen und Kastanienmännchen basteln kann. Wappnen Sie sich lieber schon mal für das nackte Grauen der Pubertät, wenn Sie sich wünschen, Sie hätten Ihr Kind niemals zum Sprechen ermutigt. Und kurz darauf kommt das Allerschlimmste: Das Kind geht meist recht fröhlich seiner Wege, und die Eltern bleiben allein zu Haus und wissen nichts mit sich anzufangen. Kann man das verhindern?
„Im Geburtsvorbereitungskurs sollte man den Eltern nicht nur Hecheln, sondern auch Beziehungsrealismus bei- bringen. Eine Aufklärungsbroschüre als Dreingabe zu jedem Neugeborenen würde die Scheidungsrate drastisch verringern“, sagt die Psychologin Micaela Peter, Autorin des jetzt erschienenen Ratgebers „Zweisam, dreisam, einsam – wie Partnerschaft auch mit Kindern lebendig bleibt“, den sie mit Ulrike Peter geschrieben hat.
Sie sagt, wie wichtig es ist, sich, bei aller Liebe zum Kind, klarzumachen, dass Kinder zu haben auch Verzicht und eine sehr reale Belastung bedeutet. Und diese Belastung geht oft mit bestimmten Symptomen einher – Erschöpfung, Frust, Gereiztheit –, die Paare fälschlicherweise als Beziehungskrise deuten. „Paare sollten schon früh ihren Kindern einen gesunden Egoismus und Selbstfürsorge vorleben. Ihnen fest in der Sache und freundlich im Ton klarmachen, dass Eltern auch noch ein eigenes Leben haben. Dazu gehört tatsächlich Disziplin, denn das Glück und die Erfüllung mit Kindern lässt leicht alles andere verblassen, sodass man sich zwingen muss, sich als Paar Zeit füreinander zu nehmen, damit nicht schleichend und und bemerkt etwas verloren geht. Einen Abend in der Woche sollte man sich reservieren und ihn so gestalten, dass er sich deutlich von den Alltagsabenden abhebt. Man kann ausgehen oder einfach nur Kerzen statt den Fernseher anmachen, zusammen müde sein, sprechen oder schweigen, zweisam sein und sich als Paar begegnen.“
Meine Familie befindet sich übrigens gerade mitten in Tiefphase Nummer zwei: ein munteres Aufeinandertreffen von Pubertät, Wechseljahren, Corona, chronischen Rückenschmerzen und Homeschooling. Trotzdem blicke ich schon jetzt wehmütig in die Zukunft und in das irgendwann leere Nest. Ich kann schlecht Abschied nehmen von Menschen, Dingen und Lebensphasen, selbst wenn sie schwierig und anstrengend sind.
Sorgen, dass ich mich mit meinem Mann langweilen werde, habe ich nicht.
Wir können alte Fotos von unseren Kindern anschauen und ab und zu heimlich „Rabe Socke“ gucken.

BRIGITTE 10/2021
Die, die auf den Eiern tanzt
Wo viel Sonne ist, da ist auch viel Schatten. Und wo viel Schatten ist, da stehen oft besonders viele Frauen. Ob Despoten oder Genies – mächtiger, auffälliger, radikaler und brutaler Narzissmus ist meistens männlich. Frauen begnügen sich immer noch zu oft mit dem Platz backstage, applaudieren laut, klagen still und bleiben weit hinter dem zurück, was
sie können und was sie einmal wollten.
„Meistens leiden Frauen unter narzisstischen Männern und werden aus ihnen nicht schlau. Sie fragen sich, warum sie sich in ein Arschloch verliebt haben – sehr häufig nicht zum ersten Mal“, sagt der Psychiater Dr. Pablo Hagemeyer, der nach eigenen und glaubhaften Angaben selbst ein Narzisst ist und das Buch mit dem rustikalen Titel „Gestatten, ich bin ein Arschloch“ geschrieben hat.
Meine gute Freundin Lydia harrte jahrelang aus in einer zerstörerischen Beziehung zu einem schillernden, anziehenden und abstoßenden Narzissten. Mal war er gereizt, mal reizend, mal war er voll des Lobes, mal explodierte er vor Wut über Nichtigkeiten. Und immer gelang es ihm, dem Meister der Manipulation, meiner Freundin das Gefühl zu vermitteln, sie sei schuld und die Beziehung würde besser laufen, wenn Lydia sich mehr Mühe gäbe. Und sie gab sich mehr Mühe. Endlose 20 Jahre lang.
„Ein Leben auf Zehenspitzen, der große Eiertanz rund um den Narzissten“, nennt das Christine Merzeder in ihrem klugen und einfühlsamen Buch „Das schleichende Gift“, in dem sie narzisstischen Missbrauch und Wege beschreibt, sich zu wehren und zu retten. Denn wer auf Eiern tanzt, ist leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. „Häufig folgt aus dem Verwirrspiel, das Narzissten perfektionieren, dass die Opfer schließlich der eigenen Wahrnehmung misstrauen“, sagt Dr. Hagemeyer. „Der Narzisst sät Selbstzweifel und verunsichert die Partnerin. Viele werden nervös, wenn Narzissten da sind. Bevor Sie sich wegen einer Schilddrüsenunterfunktion behandeln lassen, prüfen Sie, ob Sie nicht einen Narzissten zu Hause haben.“
Meine Freundin hat sich scheiden lassen. Sie ist aus dem Schatten heraus und auf die Bühne ihres eigenen Lebens getreten. „Das war wie ein Entzug von einer toxischen Droge“, sagt sie heute. Und
es hat sie Mut, Kraft und viele Tränen gekostet, ihrer eigenen Wahrnehmung wieder zu vertrauen und sich daran zu erinnern, dass sie eigene Werte hat und einen unermesslichen Wert. Schuldgefühle hat sie manchmal immer noch.
Ich finde es gut, Fehler bei sich zu suchen. Das heißt aber nicht, dass man sie dort auch unbedingt findet. Und es lohnt sich, immer wieder Beziehungen zu überprüfen: Habe ich die Freiheit, die ich mir wünsche?
Setze ich die Grenzen, die ich brauche?
Kann ich die Frau sein, die ich sein will?
Auf Zehenspitzen hat man keinen starken Auftritt.

BRIGITTE 09/2021
Zu viel und nie genug
„Wir hinterlassen durch unseren exzessiven Konsum unverzeihliche und irreversible Schäden sowohl an den Menschen am anderen Ende der Welt als auch an dem Planeten, auf dem wir leben. Das ist die große moralische Verfehlung unserer Generation.“ Ich kann diesen Satz nicht lesen, ohne mich zu schämen. Er stammt aus dem bewegenden Buch von Carl Tillessen „Konsum“, in dem ich auf jeder Seite erschrocken bin und mich ertappt gefühlt habe, und das ich mit dem Wissen beendet habe, dass ich mir jetzt sehr vieles nicht mehr schönreden kann. Das ist nicht schön. Aber sehr wichtig.
„Wir können uns nicht länger der Illusion hingeben, dass es bei der Herstellung dessen, was wir kaufen, mit rechten Dingen zugeht“, sagt Carl Tillessen mit Nachdruck. „Deutschland ist weltweit der drittgrößte Importeur von mit Sklavenarbeit hergestellter Ware. Über 90 Prozent der Produkte, die wir kaufen, werden unter unfairen Bedingungen hergestellt. Unser Wohlstand beruht darauf. Das verdrängen wir, statt unsere eigene Verantwortung anzuerkennen, fragwürdige Firmen zu boykottieren und nachhaltig und ethisch zu konsumieren.“
Der Autor klagt durch Information an, trägt erschütternde Fakten und Zahlen zusammen – ich hatte zum Beispiel keine Ahnung, dass nur ein Promille der Waren als „Fairtrade“ gekennzeichnet sind, und dass in Ländern wie Bangladesch und Kambodscha die Regierungen den gesetzlichen Mindestlohn bewusst unterhalb der Armutsgrenze festlegen, um die Auf-träge von ausländischen Großkonzernen im Land zu halten. Carl Tillessen propagiert beim Konsum ein „weniger, aber besser“ und appelliert an die Vernunft und an das Gewissen des Einzelnen. „Die Industrie hat kein Gewissen“, sagt er. Ich habe eines. Ein zunehmend schlechtes.
Wie oft lasse ich mich von Produkten verführen, die so billig sind, dass sie kaum unter menschenwürdigen Bedingungen entstanden sein können? Wie oft kaufe ich Dinge, die nicht das wert sind, was sie kosten, oder solche, die ich nicht wirklich brauche oder selten nutze, die anschließend mahnend im Küchenregal stehen oder im Kleiderschrank hängen und mir dort, egal, wie teuer oder billig sie waren, die Laune verderben? Habe ich nicht längst genug?
„Etwas in uns kennt die Antwort“, sagt Tillessen. Und das stimmt. Man muss nur hinhören wollen und bereit sein, zu verzichten. Vielleicht nicht gleich da, wo es am allermeisten wehtut. Aber früher oder später müssen wir auch große Opfer bringen, wenn wir es ernst mit unserem Anstand und dem Wohl der Welt meinen. Wenn wir informiert, auf-merksam, mit wachem Gewissen, gesun-dem Menschenverstand und ohne Selbsttäuschung konsumieren und eben auch nicht konsumieren – vom Langstreckenflug bis zum Bio-Ei –, können wir unseren kleinen, kostbaren Anteil leisten. Unseren Anteil am Versuch, die Welt zu retten.
Zu pathetisch? Egal.
Es stimmt.

BRIGITTE 08/2021
Jetzt habe ich genau den Körper, den ich immer vermeiden wollte
Schönheit ist selten und trotzdem allgegenwärtig. Körperideale machen Menschen das Leben verdammt schwer – besonders den dicken
Ich würde es niemals wagen, jemanden dick oder gar fett zu nennen. Vielleicht hinter vorgehaltener Hand, aber ich enthalte mich mittlerweile einer inneren und auch einer geäußerten Wertung über das Gewicht und die Körperformen anderer. Mit Sicherheit aber weisen mich jene Medien, die gerne und gezielt meine nie-deren Instinkte bedienen, stets auf die Abnehm-Erfolge von Mariah Carey, Adele oder einer der Frauen hin, die mit Nachnamen alle Kardashian oder Jenner heißen. Ich kann mich dem gängigen Schönheitsideal kaum entziehen, und ich spüre, wie es in mir Schaden anrichtet, mich prägt und meine Sehgewohnheiten gefährlich einseitig beeinflusst – und das, obschon ich genau weiß, dass nur wenige Prozent der Menschen diesem Ideal entsprechen.
Melodie Michelberger ist eine dicke, unfassbar mutige Frau, die den harten Kampf gegen Fettfeindlichkeit und Gewichtsdiskriminierung angetreten ist und gegen eine Diätindustrie, die ihre Umsätze mit unserem mangelnden Selbstwertgefühl macht. „Das unrealistische Körperideal macht das Leben vieler Mädchen zur Hölle. Ich habe mich über Jahrzehnte mangelernährt, um mich in eine vermeintlich ideale Form zu schrumpfen. Mein Körper war mein Gegenspieler, ich habe gegen ihn angekämpft bis zur Magersucht. Jetzt habe ich den Körper, den ich immer vermeiden wollte – aber ich bin ihm eine bessere Freundin als in den vielen Jahren zuvor.“
In ihrem bewegenden Buch „Body Politics“ beschreibt Melodie Michelberger ihren Leidensweg und ihren Kampf gegen Bodyshaming und gegen die Selbstbeschämung. „Scham und Versagen sind die allgegenwärtigen Gefühle“, sagt die Aktivistin. „Wenn eine Frau wie ich sich in Unterwäsche fotografiert, finden das viele Menschen empörend. Sie kennen meinen Körper nur als abschreckendes Beispiel. Sie glauben mir nicht, dass ich mich gut finde, so wie ich bin.“
Die Anfeindungen, denen Fettaktivistinnen ausgesetzt sind, sind brutal und menschenverachtend. Und tun schrecklich weh. Melodie Michelberger ist mit einem löchrigen Schutzschild in den Kampf gegen Körpernormen, Vorurteile und Geringschätzung gezogen und sie kämpft mit den Tränen und mit Zweifeln, wenn sie von dem Hass gegen sie berichtet.
Sie fordert Empathie und Anerkennung.
Die verletzte Frau stellt sich schützend vor verletzte Frauen.
Und das sind wir alle.

BRIGITTE 07/2021
Babys in mittleren Jahren
Wie wird und bleibt man erwachsen, wenn Unreife und Infantilität um sich greifen und geradezu zum guten Ton gehören?
Man wird sein Leben lang erwachsen. Ich zumindest. Ich kenne sie gut, die immer wieder aufkeimende Sehnsucht nach kindlicher Unschuld, nach innerlichem Rückzug in jene Seelenwinkel, in denen Papa zahlt, die anderen die Verantwortung tragen und Mama mir über den Kopf streicht und behauptet, alles würde gut. Es wird nicht alles gut, natürlich nicht. Heute bezahle ich selbst, und immer häufiger gelingt es mir, zu mir zu stehen, mich nicht zu rechtfertigen oder herauszureden und die Verantwortung zu schultern für meine Fehler, gescheiterten
Experimente, Ängste und Irrtümer, genauso wie für meine Erfolge, mein Glück und die Höhepunkte meines Lebens. Das bin alles ich. Da kann ich auch was dafür.
Der Medienwissenschaftler und Autor des hochinteressanten Buches „Die infantile Gesellschaft“ Alexander Kissler sagt: „Wir haben eine verständliche Sehnsucht nach Komplexitätsreduktion. Viele Optionen verlangen viele Entscheidungen, und davon gibt man gerne ein paar ab. Das mag ab und zu entlastend sein, führt aber letztlich zu einer besenreinen Gesellschaft, in der zu viele Menschen versuchen, sich von Irritationen, Überraschungen und Zumutungen fernzuhalten. Unreife wird zum Leitbild und Peter Pan zum Vorbild erhoben. Ich beobachte ein intellektuelles Zurückverpuppen in trotzige Ich-Haltungen. Ich sehe Realitätsverleugnung und narzisstische Weltwahrnehmung, erinnert sei hier an Donald Trump, und ein Heer von Rumpelstilzchen und Suppenkaspern, die ihr eigenes Wohlbefinden zum Maßstab aller Dinge küren, Apfelkuchen backen, Yoga machen und glauben, damit sei das Tagesziel erreicht.“
Wie widersteht man der verständlichen Versuchung des Verharrens im Bekannten? Wie überprüft man sich selbst auf kindische Schwachstellen und findet heraus aus dem Kokon aus Trotz, Furcht, Selbstbezogenheit und Schuldverleugnung?
„Es geht darum, im Kleinen Verantwortung zu übernehmen“, sagt Kissler. „Beziehungen mit einer abweichenden Meinung zu belasten. Schonräume zu verlassen, Tabuthemen anzusprechen, den Stabilitätsnarren in uns zu überlisten. Lesen Sie ein Buch von einem Autoren, den Sie ablehnen. Lassen Sie sich von Menschen und Orten überraschen, suchen Sie das Unbekannte. Delegieren Sie nicht unnötig und vorschnell, packen Sie zu, stehen Sie zu sich, ohne den Anspruch auf Perfektion, und machen Sie sich nicht abhängig vom Lob anderer. Sie wissen selbst, wie gut Sie sind.“
Das ist eine tägliche und lohnenswerte Anstrengung. Manchmal muss ich mich ganz bewusst erinnern und mir sagen: „Ich bin erwachsen. Niemandem ist es erlaubt, mich wie ein Kind zu behandeln. Auch mir selbst nicht.“
Denn ich will nicht für immer klein bleiben, zumindest nicht so, wie ich es einmal war. Ich will vielleicht wieder ein Kind werden, ab und zu. Eines, das wohlbehütet an der Hand einer Erwachsenen geht. Mama zahlt. Und die Mama bin ich.

BRIGITTE 06/2021
"Wenn der Kühlschrank lüstern flüstert"
Fasten ist total gesund und angesagt. Ildikó von Kürthy fragt sich trotzdem, warum sie sich das eigentlich antut
Die ersten Monate des Jahres beginnen bei mir traditionell eher kalorienarm, ich lasse einiges weg, manchmal auch alles, und mache eine mehrtägige Fastenkur. Dann wird die klare Gemüsebrühe zur besten Freundin und der Teelöffel Honig zum Highlight des Tages. Wehmütig erinnere ich mich vergangener Freuden in Gestalt von gutem Wein, Süßkartoffelpommes und warmem Schokokuchen mit flüssigem Kern, während ich mich selbst beim Entgiften anfeuere und mich innerlich an dem Satz des Benediktinerpaters Anselm Grün labe: „Verzicht ist Ausdruck innerer Freiheit. Und die gehört zu unserer Würde.“
Früher war meine Motivation zu fasten ganz klar: Ich will schlanker sein und besser aussehen. Heute heißt sie: Ich will leichter sein und mich besser fühlen. Ich finde, das ist ein Fortschritt und ein erfreulich erwachsener Ansatz. Hunger habe ich trotzdem.
„Gerade wir Frauen müssen uns von dem Gedankendogma lösen, schlank sei gesund“, sagt meine Freundin, die zu Recht berühmte Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck. „Ein strenges Fasten sollte mit solider, ärztlicher Begleitung stattfinden. Was aber für jeden und jede machbar und empfehlenswert ist, ist über Nacht eine Nahrungspause von mindestens zwölf Stunden bei Frauen und 13 bei Männern einzuhalten. Wenn unser Körper nicht mit Nahrung umgehen muss und keinen Insulinreiz erhält, wird der Prozess der Autophagie, die zelleigene Müllabfuhr, aktiviert. Deswegen sollte aus dem Frühstück lieber ein Spätstück werden.“ Das wiederum gelingt mir spielend, da ich mich abends meist an Portionen halte, die einen Grizzlybären mitsamt Familie durch den Winterschlaf bringen könnten. Leider sind in meinem Kopf die Begriffe „gesund“ und „freudlos“ fest aneinander gekoppelt, während Genuss für mich stets mit einer gewissen Maßlosigkeit einhergeht und ich es keinesfalls als Grund empfinde, aufzuhören zu essen, nur weil ich satt bin.
„Gesunde Ernährung klingt unästhetisch“, gibt mir Anne Fleck immerhin recht. „Aber gesundes Essen kann selbstverständlich genussvoll und auch überschwänglich sein und hat auf keinen Fall was mit Kalorienzählen zu tun. Naschen ist kein Tabu und am besten tut man es nicht zwischendurch, sondern gleich nach der Hauptmahlzeit.“
Der Körper brauche Pausen, sagt Anne Fleck. Und wenn mich Heißhunger überkommt, soll ich mir kurz Zeit nehmen innezuhalten, meine Gefühle einzuordnen und dann den Faden der Gewöhnung abschneiden und statt zu essen etwas anderes tun. Eine Schublade aufräumen zum Beispiel.
Anne Fleck besitzt diese undogmatische, sanfte Stimme der Vernunft, mit der sie darum wirbt, sich selbst nicht zu streng zu bewerten und liebevoll und geduldig am eigenen Essverhalten zu arbeiten. Ich tue das mal mehr, mal weniger erfolgreich. Jetzt zum Beispiel scheint der Kühlschrank heiser, geradezu lüstern meinen Namen zu flüstern, um mich an die diversen Käsesorten in seinem Inneren zu erinnern. Gut, dass es in meinem direkten Umfeld eine ganze Menge unaufgeräumter Schubladen gibt.
Danke, Anne!

BRIGITTE 05/2021
"Unsere Gefühle sind nicht unsere Chefs"
Emotionen beeinflussen unsere Gesundheit. Und umgekehrt.
Aber wir sind ihnen nicht hilflos ausgeliefert – das müssen wir nur erkennen
Ich habe immer noch die Sehnsucht nach der einen Tablette. In meiner Fantasie sehe ich einen gütigen Arzt seinen Rezeptblock zücken, den mehrsilbigen Namen eines Medikaments darauf notieren. Ich höre den Doktor sagen: „Morgens und abends eine, dann sind Sie bereits in wenigen Tagen beschwerde-frei.“ Und tatsächlich: Eine Woche später bin ich ein neuer Mensch, mache mir nichts mehr aus den handelsüblichen Suchtstoffen, habe ein astreines Immunsystem, eine robuste Psyche, strotze nur so vor Resilienz und Optimismus, schlafe tief, und wenn ich wach bin, bin ich glücklich und zufrieden.
Die Erfahrung und das Wissen von Experten legt bedauerlicherweise nahe, dass diese Hoffnung unbegründet ist. Der Neurobiologe Prof. Gerald Hüther hat dazu bereits unmissverständlich behauptet: „Niemand kann einen anderen Menschen gesund machen. Jede Heilung ist daher immer und grundsätzlich Selbstheilung.“
Sowohl das neue Buch „Die gestresste Seele“ als auch das Gespräch mit Prof. Dr. med. Gustav Dobos, Direktor der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin in Essen, machen mir einmal mehr klar: Es geht darum, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen, die viel mit unseren Vorstellungen, Gefühlen, Haltungen zu tun hat. Unsere Seele beeinflusst den Körper. Umgekehrt genauso. „Der Zustand unseres Körpers spielt eine entscheidende Rolle für unsere Emotionen. Den Körper zu harmonisieren heißt, die Psyche zu harmonisieren.“ Und tatsächlich, so sagt Herr Dobos, lassen sich bei 40 bis 50 Prozent der Menschen, die ihren Hausarzt aufsuchen, keine körperlichen Ursachen ihrer Beschwerden finden.
Es ist allein der Stress, der Körper und Seele schadet, der unser Immunsystem angreift.
Sind wir also alle selber schuld an unseren Krankheiten, egal ob wir einen Schnupfen oder einen Tumor haben?
„Stress ist keine Frage von Schuld“, sagt Prof. Dobos. „Es geht darum, zu zeigen, wie viel wir selbst tun können, um gesund zu bleiben oder zu werden. Massage, Berührung, Bewegung, Meditation, Fasten, Yoga, Akupunktur, Selbstfürsorge, gesunde Ernährung, soziales Mit-einander – das alles sind Faktoren, die massiven Einfluss auf unsere Gefühle und damit auch auf unsere Gesundheit haben. Wir sind unseren Gefühlen nicht ausgeliefert, Emotionen sind keine Vorgesetzten.“
Mein Wunsch: Herrin werden im eigenen Haus. Gefühls-Chefin. Head of Hirn. Direktorin meines Körpers und Oberhaupt meines Kopfes. Dafür gibt es leider keine Tablette und dahin führt kein leichter und auch kein kurzer Weg.
Wie das eben so ist mit Führungspositionen: Man muss sie sich erarbeiten, man muss sie verteidigen, man muss Macht wollen und vor allem Verantwortung übernehmen. Dann mal los.

BRIGITTE 04/2021
"Danach hatte ich nicht gefragt"
Männer erklären gern die Welt. Warum eigentlich?
Wissen sie mehr, oder fehlt es ihnen an der rechten Dosis Selbstzweifel?
Ich habe große Selbstzweifel. Und ich habe sie gern. Was soll daran so schlimm sein, mich immer wieder zu fragen, ob ich auf dem rechten Weg bin, ob ich recht habe, oder ob es gar nicht ums Recht-haben geht; ob ich so, wie ich bin, gut bin, und ob ich so bleiben möchte. Der Zweifel gehört zum Selbstbewusstsein wie die Hefe in den Pizzateig. Es gärt, es wächst, es reift. Wer schon alles zu kennen glaubt, lernt nichts Neues mehr. Zweifeln heißt nachfragen, und Selbstzweifel ist die Neugier auf eine andere, bessere, durchdachtere Version des eigenen Ichs. Mich gruselt es vor jenen Selbstzufriedenen, die sich Entwicklungen versperren, alles zu wissen glauben und vor allen Dingen alles besser.
In meiner Wahrnehmung – und die fraglos vielen, auf die diese Beobachtung nicht zutrifft, mögen mir verzeihen – sind das oft Männer. Aufgewachsen mit und geprägt von der Erwartung, männliche Macher sein zu müssen, auf jede Frage eine Antwort zu haben und erst mal zu behaupten, man wisse, wo es langgeht, auch wenn man keine Ahnung hat.
„Das scheint ein zutreffendes Klischee zu sein. Ich habe die besseren Gespräche mit Frauen“, sagt Gerburg Jahnke. Die Kabarettistin und Regisseurin ist Mitte 60 und genervt von „den Jungs in meinem Alter, die mir die Welt erklären, obwohl ich sie nicht darum gebeten habe. Die formulieren hauptsächlich IchSätze, die oft mit einem Ausrufezeichen und selten mit einem Fragezeichen enden. Der Mann bei mir zu Hause neigt auch dazu. Ich nenne das ‚Erklärtourette‘, und es geht mir auf den Wecker. Da werde ich auch zunehmend ungehalten, unterbreche und sage: ‚Danach hatte ich nicht gefragt.‘“
Gerburg Jahnke hat nach eigenen Angaben vor vielen Jahren „ganz schlimm Feminismus bekommen“, und ich würde mich nicht wundern, wenn ich mich im Gespräch mit ihr angesteckt hätte. Sie erzählt von ihrem inneren Oberlandesgericht, das ständig und streng urteilt – über sie selbst und andere, dass sie gerne milder würde, es ihr aber doch sehr schwerfalle bei einem Blick in die Welt, wo an entscheidenden Positionen immer noch zu viele „gestrige Autokraten sitzen. Selbstzweifel, Teamgeist, Risikovermeidung, Empathie – das sind Führungsqualitäten! Und die alten Säcke haben keine einzige davon!“
Wie wohl es doch tut, im Bekenntnis zum Zweifel zueinanderzufinden. Wie viel Energie wir (und besonders Ihr :) ) sparen könnten, würden wir auf MachtRituale, Besserwisserei und anstrengendes Posieren verzichten und lieber gleich zur Sache kommen. Besinnung auf die traditionell weiblichen Eigenschaften. Möglich ist es.
Der Weg ist jedenfalls beschritten. „Und der Rest ist Zukunft“, sagt Gerburg Jahnke. Womit sie ganz zweifellos recht hat.

BRIGITTE 03/2021
"Keine Ehe vor dem Sex!"
Gibt es überhaupt noch sexuelle Tabus?
Ist nicht längst alles ausgesprochen – und zwar deutlicher, als uns lieb ist?
Anscheinend nicht
Dafür bin ich zu alt. Sex. Ich mag nicht mehr drüber reden. Bin durch mit dem Thema. Alles ist gesagt, beklagt, diskutiert. Ich bin total aufgeklärt, so wie wir alle, und kann meine Wissbegierde nun endlich voll auf mir bis dato unbekannte Bereiche wie Radwandern, Angeln und Soßenbinden richten.
Die Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning sieht das anders. Sie sagt: „Wir leben immer noch in einer sehr verklemmten Gesellschaft. Es gibt zwar genügend Informationen, aber sobald wir selbst ein Problem haben, sprechen wir nicht gern darüber. Es gibt noch viele Märchen da draußen.“
Das entlockt mir ein nachsichtiges Lächeln. Wurde unsere Sexualität nicht durchleuchtet wie ein verdächtiges Gepäckstück bei der Einreise in die USA? Blieb da tatsächlich noch irgendwas unentdeckt? Ann-Marlene sagt: „Ich bin zum Beispiel empört, dass Frauen immer noch darunter leiden müssen, dass es angeblich ein Jungfernhäutchen gibt. Das ist eine Männerlüge. Im Mutterleib hat der weibliche Embryo diese Schutzhaut. Sie öffnet sich bei der Geburt, und dann bleibt höchstens ein kleiner Rest davon zurück, eine Art Kranz. Das hat zur Folge, dass Mädchen Angst haben, dass der erste Sex wehtut, und Jungs sich umgekehrt fürchten, ihrer Partnerin wehzutun. Das ist immer noch der Start von Sexuaität: Wir rechnen mit Schmerz.“
Das ist für mich tatsächlich eine Neuigkeit – und ein Skandal. Wie viel Diskriminierung und Scham wäre Frauen erspart geblieben, wenn man ihnen nicht jahrhundertelang erzählt hätte, dass sie eine Art Frischhaltefolie zwischen den Beinen hätten, die ihre Unversehrtheit beweist und den Zugang zu ihrer Sexualität versperrt wie der dreiköpfige Höllenhund den Eingang zum Totenreich?
Scham ist noch ein weiteres Stichwort, auf das die Expertin allergisch reagiert. Jene falsche Scham, die immer noch hauptsächlich Frauen einredet, sie seien nicht als lustvolle Wesen gedacht, sie seien nicht schön genug für guten Sex, ihre Brüste seien zu klein, der Hintern sei zu dick und, mittlerweile hat der Schönheitswahn auch das weibliche Geschlechtsorgan erreicht, ihre Schamlippen seien zu groß. In Frauen-Köpfen wimmelt es von Sätzen, die beginnen mit „Das macht man nicht ...!“
„Ja, das ist immer noch ein Thema“, sagt Ann-Marlene Henning. „Wie besonders der weibliche Körper von Anfang an mit Scham, sogar Ekelgefühlen behaftet wird! Du bist ekelig, du riechst schlecht, du schmeckst schlecht. Wir sagen zum Beispiel ‚Schamlippen‘, aber nicht
‚Schambeutel‘ zum Hodensack – dabei ist es dasselbe Gewebe. Das ist angelernte Scham. Männer können Frauen nicht kontrollieren, wenn sie lustvoll sind – also hat man sie lustlos gemacht!“
Vielleicht bin ich doch noch nicht zu alt für Aufklärung. Vielleicht bin ich sogar gerade alt genug, um Sexualität wieder zum Thema zu machen. Sex, Lust und das uralte Märchen von der völlig falschen Scham der Frauen.

BRIGITTE 02/2021
"Will ich das?"
Oder soll ich das wollen?
Diese Frage sollte man sich stellen, wenn man mal wieder zögert oder aufschiebt oder mutlos ist.
Oft ist die Antwort erstaunlich eindeutig
Ich habe ein paar Ideen. Das schon. Bloß bleiben die meisten von ihnen unverwirklicht. Sie stecken fest irgendwo auf dem steinigen Weg zwischen Imagination und Wirklichkeit und haben sich ihren drei schlimmsten Feinden ergeben: der Trägheit, den Bedenken und dem Zögern. Manchmal, so wie jetzt zu Jahresbeginn, regen sie sich noch, die alten, gebrechlichen Ideen, versuchen noch mal auf die Beine zu kommen, schnell entmutigt durch die niederschmetternden Sätze:
„Zu spät, zu alt, zu riskant, vielleicht im nächsten Jahr oder im nächsten Leben.“
„Das Leben ist eine Ansammlung von Selbstversuchen mit ungewissem Aus-gang“, sagt Meike Winnemuth. Und für ihr Leben stimmt das. Mit 60 Jahren hat die Journalistin und Autorin der klugen und inspirierenden Bestseller „Das große Los“ und „Bin im Garten“ wirklich verdammt viele und sehr besondere Selbst-versuche gemacht. Dabei scheut sie das Versagen nicht und nicht den Wider-spruch und weiß genau, wer in der Lage wäre, ihr die größten Steine in den Weg zu legen: „Ich verwirkliche Ideen schnell, bevor ich mich durch zu vieles Grübeln davon abhalten und mir dazwischen quatschen kann. Niemand kann mich stoppen – nur ich selber“, sagt sie. „Ich habe lange Zeit meines Lebens damit zugebracht – das ist eine Sache speziell der weiblichen DNA –, unzufrieden mit mir zu sein. Seit Mitte 40 weiß ich, was ich will und bin auch bereit, von einmal getroffenen Entscheidungen wieder zurückzutreten.“
Hat sie Ratschläge zum Finden von Ideen? Ein paar handfeste Tipps, wie zum Reinigen von Backöfen, mit denen man dem Leben etwas Glanz verleihen kann? Ich hoffe immer noch auf schnelle Lösun-gen, obwohl ich längst weiß, dass es die nicht gibt. Natürlich nicht. Und so ant-wortet weise und milde amüsiert Meike Winnemuth: „Ich habe keine Ratschläge zum Finden. Aber zum Suchen. Man muss sich die Grundfrage stellen: Will ich das oder soll ich das wollen? Ich bin rela-tiv gut darin, meine eigenen Wünsche, die recht oft abweichen von denen, die gesellschaftlich erwünscht sind, zu definieren und denen nachzugehen. Das ist nicht immer leicht. Viele Leute stehen sich selbst im Weg, indem sie vorher ganz genau wissen wollen, wie etwas aus-geht. Aber Ziele sind oft im Weg. Man muss sich erlauben, auszuprobieren und sich von dem Druck befreien, dass das Leben unbedingt in jedem Punkt gelingen muss. Bin ich mutig? Nein, es ist was anderes. Sich trauen heißt, sich selbst vertrauen. Was haben wir nicht schon alles geschafft!? Wir sollten darauf ver-trauen, dass, was immer da noch kommt, auch zu schaffen ist. Warum die Furcht!?“
Suchen.
Statt finden. Wege wagen.
Statt kleinlich Ziele definieren. Sich aufmachen, sich ausprobieren, notfalls umdrehen und einen neuen Versuch starten. Mal schauen, was da noch schlummert an Ideen und Sehnsüchten. Warum nicht jetzt?

BRIGITTE 01/2021
„Das Ei nimmt sich, was es will!“
Ich nehme mir die Zeit
...ohne Rezept zu kochen
...meine Spezialität zu entdecken
...Nudeln selber zu machen
Ich koche grundsätzlich ohne Gene. Mir mangelt es an angeborenem Talent zur lässigen und rezeptlosen Zubereitung essbarer oder gar gelungener Malzeiten. Und mir fehlt sowohl der Mut als auch die Abenteuerlust, unerschrocken Zutaten und exotische Gewürze zu kombinieren, deren Namen mir so unbekannt sind wie die Vororte von Damaskus. Um dieses genetische Defizit durch erworbenes Wissen auszugleichen, habe ich die kluge und wunderbare Sterneköchin Léa Linster in meine Küche gebeten, wo sie auf stumpfe Messer, olle Töpfe und einen schönen, aber schwierigen Herd trifft. „Das Leben gehört den mutigen Frauen,“ ruft Frau Linster entschlossen und versorgt mich mit Koch- und Lebensweisheiten, während sie unerschrocken wie die Amazonenkönigin Penthesilea nach dem Kartoffelschäler greift. „Nicht alles ist ein Fehler, was zunächst danach aussieht. Vielleicht erfinden Sie versehentlich etwas Neues. Haben Sie keine Angst! Wenn es nicht das wird, was es werden sollte, dann taufen Sie es einfach um.“
„Und wenn es nicht schmeckt,“ frage ich zimperlich und bewundere ihre Art, Zwiebeln zu schneiden und reichlich Butter in einem eleganten Bogen aus der Hüfte heraus ins Mehl zu werfen. „Zack!“ ruft die Amazone fröhlich. „Was heißt denn schon nicht schmecken? Wenn wir zum ersten Mal einem Marsmännchen begegnen, wissen wir ja auch nicht, ob es hübsch ist oder nicht, solange wir die anderen noch nicht gesehen haben.“
Ich darf ein paar Basilikumblätter abzupfen, während Léa Linster mir sagt, dass Knoblauch und Ingwer sich gut vertragen, ein wenig angerösteter Kurkuma die Farbe unserer Suppe rettet, Eier sich stets soviel Mehl nehmen, wie sie brauchen und Äpfel von außen und Birnen von Innen faulen.
Meine Küche ist nicht wiederzuerkennen. Es scheint, als blühe sie unter den Händen der Haut-Cuisine-Göttin auf. Die Messer scheinen schärfer und der Herd weniger launisch zu sein.
„Sie müssen sich eine Spezialität aneignen,“ rät mir Léa Linster. „Etwas, was nur Sie genauso kochen können und was Ihre Gäste immer wieder essen wollen.“ Hilfesuchend schaue ich nach meinen Kochbüchern. Frau Linster bemerkt meinen Blick und sagt: „Ihre Spezialität muss vom Herzen kommen, und dafür brauchen Sie kein Rezept. Denn wenn es in einem Buch steht, ist es ja schon die Spezialität von jemand anderem.“
Am Ende dieser Lehr-Stunden ist aus meiner Küche eine Sterne-Küche geworden und ich darf ein unvergleichliches, köstliches Menü aus Linsensuppe, Coq au Vin und Apfel-Tarte genießen. Beschwingt verabschiede ich die Meisterin des mutigen Kochens mit der festen Absicht, mir eine Nudelmaschine, eine Tarte-Form und neue Messer zuzulegen. Und mehr Mut. „Wenn nichts alles glatt läuft, ist man gerade mitten in einem Abenteuer,“ sagt Léa Linster zum Abschied. Und schon hab ich wieder was fürs Leben gelernt. Guten Appetit!

BRIGITTE 26/2020
Da geht noch was!
Die Versuchung ist groß. Decke über den Kopf, Kekse knabbern und dabei leise maulen, dass die gute, alte Weihnachtszeit auch nicht mehr das ist, was sie mal war. Im Grunde genommen ist ja nichts mehr das, was es mal war. Sehr bedauerlich. Die Kinder werden groß, die Knochen werden alt und jetzt neigt sich auch noch das Jahr dem Ende zu. Es war, weiß Gott, kein gutes Jahr.
Mut und Energie waren Mangelware, der Abstand und die Enge sind zur Normalität geworden, während unser Leben zusammengeschnurrt ist wie eine zu heiß gewaschene Wollsocke. Was geht noch, wenn so gut wie nichts mehr geht?
Als Maria Furtwänglers Vater an Alzheimer erkrankte, gab ihr eine Freundin den Rat, sich nicht auf das zu konzentrieren, was von Tag zu Tag, von Stunde zu verloren ging, sondern auf das, was ihm und ihr blieb. Bis zu seinem Tod hat sie diesen Rat beherzigt und sie versucht bis heute, den Focus in ihrem Leben auf die Möglichkeiten, statt auf die Unmöglichkeiten und die Verluste zu richten.
„Es ist ohne Frage so, dass ein viel stärkeres Bewusstsein ob meiner Endlichkeit eingesetzt hat,“ sagt sie mir. „Ich ertappe mich dabei, dass ich mich am Ende des Sommers frage ‚Wie viele Sommer habe ich noch?‘ Aber vieles wird durch dieses Bewusstsein kostbarer und ich habe mehr denn je das Gefühl, es fängt doch gerade erst so richtig an, Spaß zu machen! Natürlich ist das Leben als knackiges, scharfes Ding vorbei – aber die Energie, die jetzt frei wird, die Möglichkeiten gepaart mit der Erfahrung und den neuen Freiheiten, die wir haben, finde ich sensationell!“
Maria Furtwängler hätte auch sehr schön als Motivationstrainerin arbeiten können, wenn sie nicht schon Ärztin, Schauspielerin, Feministin und seit drei Jahren auch Produzentin wäre. Wir sind seit etlichen Jahren befreundet, eine Beziehung die, wie man sich denken kann, stets bereichernd, aber nur selten von faulem, sich gegenseitig gemütlichem Bemitleiden geprägt ist.
„Ich habe sehr spät eine eigene Firma gegründet, weil ich mir vieles nicht zugetraut und mit Staunen die jungen Männer gesehen habe, die einen Film nicht nur inszeniert, sondern auch gleich produziert haben,“ sagt Maria. „Die Angst, es nicht gut genug zu machen, und mein Perfektionismus haben mich gehemmt. Wie vielen Frauen hat auch mir die Bereitschaft zum Scheitern gefehlt. Aber ich bin sehr viel mutiger geworden.“
Das ist ermutigend. Es tut gut, solche starken Frauenstimmen zu hören, besonders wenn man selbst, wie ich, hin und wieder zu Jammerlappigkeit und Verzagtheit neigt. „Das, was unabänderlich ist, sollten wir mit liebevollem Humor nehmen. Der Körper entwickelt sich hin zu einem Zustand, in dem man ihn nie sehen wollte. Der Hintern hängt und die Beine sehen auch nicht mehr aus, wie mit 20. Aber sie haben mich schon so viele Berge hinaufgetragen und ich empfinde eine große Zärtlichkeit gegenüber meinen Beinen und meiner Endlichkeit, die mich mit den Frauengenerationen vor mir verbindet. Das hat etwas Versöhnliches.“ Bergsteigen also. Warum nicht?